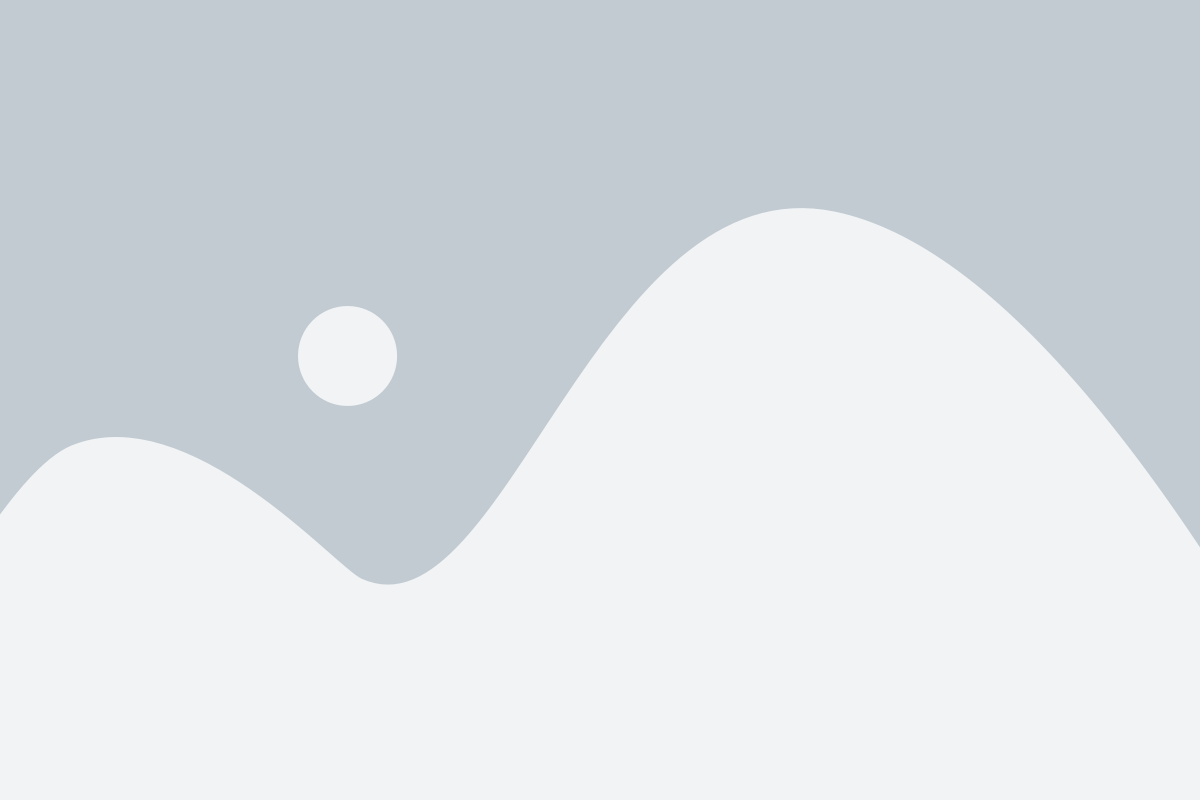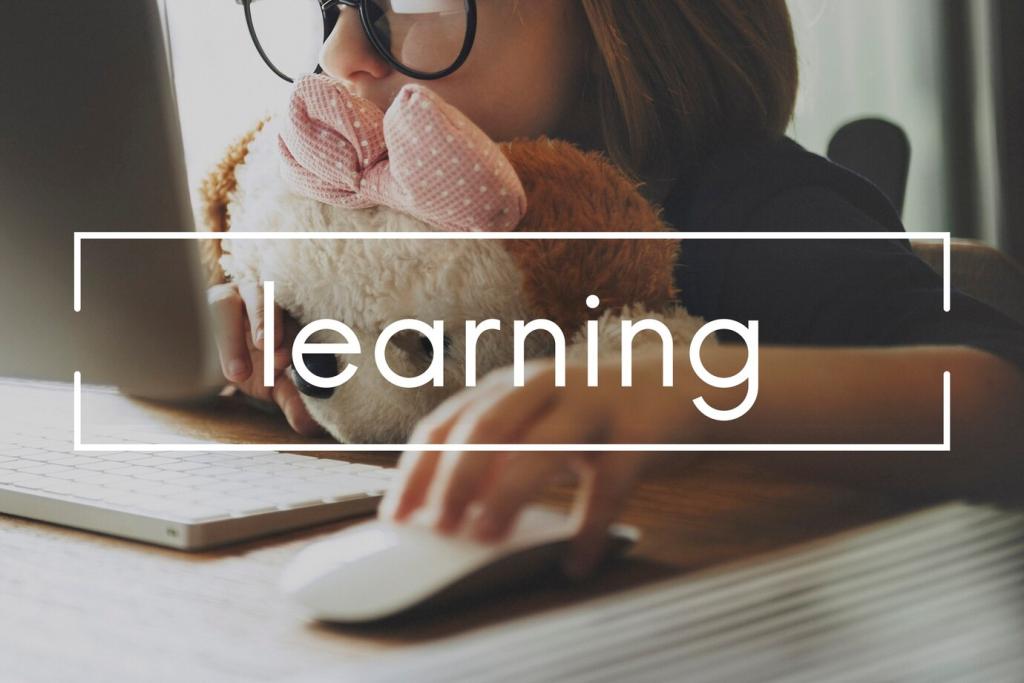Entscheidungsmatrix: Wann Low-Code, wann No-Code?
Wenn Ihr Prozess einfache, standardisierbare Abläufe abbildet, ist No-Code unschlagbar schnell. Benötigen Sie komplexe Regeln, wiederverwendbare Module oder anspruchsvolle Datenverarbeitung, ist Low-Code im Vorteil. Mischen ist möglich, wenn Schnittstellen sauber gestaltet sind.
Entscheidungsmatrix: Wann Low-Code, wann No-Code?
Leichte Integrationen zu gängigen SaaS-Diensten gelingen oft per No-Code-Connector. Für Legacy-Systeme, maßgeschneiderte APIs oder eventgetriebene Architekturen liefert Low-Code mehr Kontrolltiefe. Entscheidend ist, Datenqualität und Latenzen früh zu berücksichtigen.